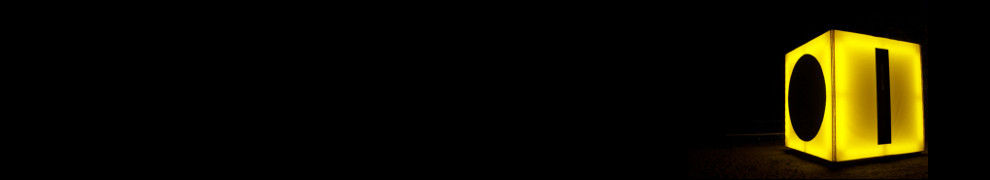Die Luft in dem Gewächshaus am Berliner Müggelsee riecht feucht und etwas modrig, die Innentemperatur beträgt knapp 26 Grad Celsius. Pumpen brummen, Wasser plätschert, Tomatenstauden ringeln sich in die Höhe. Dazwischen tummeln sich goldrote Fischschwärme in gewaltigen schwarzen Plastikfässern. Es sind Tilapien aus der Familie der Buntbarsche, zappelige Dinger, die jedem, der seine Nase zu neugierig in ihre Becken steckt, eine Dusche verpassen.
Werner Kloas ist einer der Erfinder dieses Tomaten-Barsch-Hauses. Am Leibniz-Institut für Binnenfischerei und Gewässerökologie (IGB) leitet der Zoologe die Abteilung Ökophysiologie und Aquakultur. Ihn treibt eine große Frage um: Wie lassen sich im Jahr 2050 mehr als 9 Milliarden Menschen ausreichend und ausgewogen ernähren – und zwar ohne die zweifelhaften Methoden der konventionellen Landwirtschaft? „Man wird die bestehenden Anbauflächen kaum erweitern können“, ist der 56-Jährige überzeugt. Kloas‘ Antwort lautet daher: „Wir müssen Kreisläufe schließen.“ Zum Beispiel, indem man Gemüse mit Fischabwässern düngt – das Prinzip Aquaponik.

In der IGB-Pilotanlage des „Tomatenfischs“ (Quelle: IGB Berlin)
Schon die alten Chinesen machten sich solch kombinierte Fisch-Gemüsezuchten zunutze, indem sie Schmerlen und Karpfen in ihren Reisfeldern hielten. Jahrtausende später schicken sich quer über den Globus Forscher wie Werner Kloas an, die Aquaponik für die Neuzeit fit zu bekommen. Ihr Ziel: Den steigenden Fischbedarf in aller Welt zu decken, und zwar ohne die Umweltfolgen vieler bestehender Aquakulturen. Ihre Lösung: Das Zusammenschalten von kreislaufartigen Fischzuchtanlagen, sogenannten Recirculating Aquaculture Systems (RAS), mit hydroponischen Gemüsekulturen, die nicht in Erde, sondern einer Nährlösung gedeihen – auf dass sich beide in einer Quasi-Symbiose gegenseitig ergänzen, die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt und natürliche Ökosysteme so wenig wie möglich belastet werden.
Wie das im Einzelnen aussieht, welche Verheißungen, aber auch Kniffligkeiten damit verbunden sind und wie Start-Ups und Entrepreneure diese Idee bereits in Form von Dach- und Stadtfarmen in die Praxis holen, habe ich mir für die Mädels und Jungs von Perspective Daily näher angeschaut. Voilá: Fish’n’Ketchup!