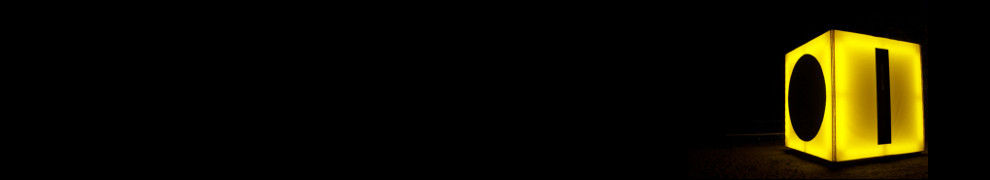Mächtige Hirschtrophäen zieren das Foyer von Schloss Berleburg. An den Wänden zeigen historische Stiche Szenen einer Hasen- und Sauenhatz, eine Ahnengalerie präsentiert gewichtige Persönlichkeiten. Der Bau im Renaissancestil ist Stamm- und Wohnsitz der Familie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, einem Adelsgeschlecht, dessen Wurzeln bis in das 12. Jahrhundert zurück reichen. Einer der Hausherren, Prinz Gustav, sitzt Anfang Mai mit schwarzer Daunenweste und schweren Bergstiefeln vor Pressevertretern auf einem Podium im Schlossfoyer und sagt, es sei „ein spannendes Jahr“ gewesen. Er redet nicht von der Jagd auf Hasen, Wildschweine oder Hirsche. Prinz Gustav redet von den Wisenten, die erstmals seit Jahrhunderten wieder durch einen westeuropäischen Wald ziehen.
Rückblende: Es ist der 11. April 2013, als sich für Abdia, Abtisa, Araneta, Dareli, Daviedi, die Queen vom Rothaarsteig sowie Egnar und Quandor die Tore zur Freiheit öffnen. Knapp drei Jahre haben die sechs Kühe und die zwei Bullen in einem Auswilderungsgehege nördlich der Kleinstadt Bad Berleburg gelebt. Nun soll die Herde in den umliegenden Wäldern des Rothaargebirges tun und lassen dürfen, was ihnen gefällt. Mehr oder weniger jedenfalls.
Die Idee dazu hatte Prinz Richard, der Vater von Gustav und das Oberhaupt der zu Sayn-Wittgenstein-Berleburgs. Die Familie betreibt in der Region die größte private Forstwirtschaft Nordrhein-Westfalens, insgesamt 13.000 Hektar Wald, in dem vor allem Fichten und Buchen wachsen. Hier brüten seltene Vögel wie Schwarzstorch oder Raufußkauz, und im Jahr 2003 kam Prinz Richard dann auf den Gedanken, einen Teil seines Forsts auch den Wisenten zur Verfügung zu stellen. Immerhin seien die Riesen, so erklärte er es einmal in einem Interview, „wunderbare, faszinierende Tiere“, die obendrein in die örtliche Landschaft gehörten.
Tatsächlich lag Deutschland einst mittendrin im Wisent-Populationsgebiet. Bison bonasus, so der wissenschaftliche Name des massigen Wildrinds, war als „König der Wälder“ ursprünglich in drei Unterarten von Frankreich und Spanien bis zur Wolga sowie dem Kaukasus verbreitet. Forst- und Landwirtschaft sowie Jagd und Wilderei dezimierten den Bestand jedoch immer mehr, bis 1927 im Kaukasus der letzte freilebende Wisent geschossen wurde.
Das Aussterben der Art konnte trotzdem abgewendet werden, wenn auch nur um Haaresbreite: In Tiergärten existierten Anfang der Zwanziger noch 54 Exemplare, so dass engagierte Biologen und Zoodirektoren ein aufwändiges Zuchtprogramm auflegten. 1952 konnten die ersten Wisente wieder ausgewildert werden, im Urwald von Białowieża an der polnisch-weißrussischen Grenze, ähnliche Projekte in der Ukraine, Russland, der Slowakei und Litauen folgten.
Heute gibt es weltweit wieder mehr als 5000 der massigen Rinder. Knapp zwei Drittel davon entfallen auf die freien Populationen Osteuropas, und wie dort sollen die Wisente auch in mittel- und westeuropäischen Wäldern abermals heimisch werden – zumindest wenn es nach den zu Sayn-Wittgenstein-Berleburgs und ihren Mitstreitern geht. Johannes Röhl, der als Forstdirektor die Geschäfte im fürstlichen Wald führt, sagt beim Pressetermin auf Schloss Berleburg, Hauptziel aller Beteiligten sei es, „dabei behilflich zu sein, dem Wisent in einem Freilandprojekt beim Überleben zu helfen“. Denn trotz aller Nachzuchterfolge stehe die Art noch immer vor einer „genetischen Katastrophe“.
Was Röhl meint, ist der Umstand, dass die Anfang der Zwanziger Jahre verbliebenen Wisente von lediglich zwölf Gründertieren abstammten. Auch heute noch resultiert daraus eine hohe Inzuchtgefahr sowie die Anfälligkeit für Krankheiten. Jedes Individuum ist daher im Internationalen Wisent-Zuchtbuch registriert, um die Rekombination von geeigneten Elterntieren koordinieren zu können und so den globalen Bestand weiter wachsen zu lassen.
Diese Strategie ist freilich darauf angewiesen, bestehende Herden zu erweitern und neue zu entwickeln – wie jetzt im Rothaargebirge. Schon vor dem Auswilderungsprojekt galt Deutschland als wichtige „Wisentnation“, mit mehr als 500 Tieren in Zoos oder großen Freigehegen wie der Döberitzer Heide. Um sie nun auch in freier Wildbahn wieder ansiedeln zu können, sagt Forstdirektor Röhl, brauche es keine Urwälder wie in Osteuropa. „Uns geht es darum, Mut zu machen und zu zeigen, so ein Projekt geht auch im Wirtschaftswald.“
Das sehen nicht alle so. Zwar sind Kreis- und Landespolitik mit im Boot, nicht zuletzt aus Gründen des Regionalmarketings, auch das Bundesamt für Naturschutz begleitet das Projekt. Waldbesitzer im benachbarten Hochsauerlandkreis jedoch klagen seit der Freilassung der Wisente über Schälschäden an ihren Bäumen – und sind jetzt vor Gericht gezogen, um zu verhindern, dass sich die Riesen weiterhin an der Rinde ihrer Buchen gütlich tun.
Noch ein wenig ausführlicher nachzulesen ist das alles in der aktuellen Ausgabe des naturgucker Magazins, für die ich die Auswilderung der Wisente im Rothaargebirge samt ihrer Schwierigkeiten etwas ausführlicher beschrieben habe (eine Vorschau auf das Heft gibt es hier). Es ist eine Geschichte über den grundsätzlichen Konflikt, Wildnis und Zivilisation unter den gegebenen Umständen in Einklang zu bringen. Mit offenem Ausgang.